Das Osservatorio culturale del Cantone Ticino organisiert in Zusammenarbeit mit der Stadt Locarno am 8. August im Corte di Casa Rusca in Locarno eine Diskussionsmatinee zum Thema «Audiovisuelles Erbe». Im Mittelpunkt steht die Rolle lokaler Behörden, Institutionen sowie öffentlicher und privater Akteure bei der Bewahrung und Aufwertung dieses Erbes. Auch Cécile Vilas, Direktorin von Memoriav, wird aktiv an der Veranstaltung teilnehmen und sich in die Diskussion einbringen.
Die Diskussion wird mit zwei informativen Beiträgen eröffnet, die die heute bereits verfügbaren Möglichkeiten und Instrumente präsentieren. Im Anschluss findet ein Podiumsgespräch statt, in dem Kommunalarchive, Rundfunkarchive und Verbände ihre Erfahrungen austauschen, um über Gegenwart und Zukunft des audiovisuellen Erbes zu diskutieren. Ziel ist es, eine Reihe von Fragen zu erörtern, die für dieses Kulturgut von Bedeutung sind. Wie steht es heute um das lokale audiovisuelle Erbe? Welchen Bedarf gibt es in Bezug auf Erhaltung, Digitalisierung und Zugang? Wo sollten wir ansetzen, um ein entsprechendes Projekt zu initiieren?
Die Veranstaltung ist offen für alle und gratis: Zum Programm

Der Exekutivrat der UNESCO in Paris hat der Aufnahme der Nachlässe der Schweizer Schriftstellerinnen Annemarie Schwarzenbach (1908-1942) und Ella Maillart (1903-1997) in das Register des Weltdokumentenerbes zugestimmt. Damit würdigt das Gremium zwei Pionierinnen des Reisetagebuchs. Die Nachlässe werden in der Bibliothèque de Genève, im Musée Photo Elysée in Lausanne und im Literaturarchiv der Schweizerischen Nationalbibliothek in Bern aufbewahrt. Sie widerspiegeln die künstlerische und kritische Auseinandersetzung der beiden Schriftstellerinnen mit den prägendsten Konflikten des 20. Jahrhunderts, die bis heute relevant ist.
Auf Initiative von Memoriav haben im Herbst 2023 die Schweizerische Nationalbibliothek, die Bibliothèque de Genève und das von der Stiftung Plateforme 10 verwaltete Waadtländer Museum für Fotografie, Photo Elysée, die Kandidatur «Annemarie Schwarzenbach und Ella Maillart: Weibliche Blicke auf die Welt» eingereicht. Die beiden Wegbereiterinnen des Reisetagebuchs gehören zu den wichtigsten Figuren der Schweizer Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts.
Weibliche Blicke auf die Welt
Annemarie Schwarzenbach und Ella Maillart revolutionierten das bis dahin von Männern dominierte Genre des Reisetagebuchs und machten es auch zu einem literarischen und visuellen Medium weiblicher Ausdruckskraft. Ihre finanziell und technisch völlig autonom durchgeführten Expeditionen in entlegene Weltregionen sowie ihre Reportagen über das Leben von Frauen in Entwicklungsländern zeigen eindrücklich, was zu dieser Zeit möglich war.
Ihre gemeinsame Reise nach Afghanistan im Jahr 1939 steht im Zentrum ihres künstlerischen Erbes. Sie rief ein breites Medienecho hervor und hinterliess einen nachhaltigen Eindruck. Das literarische und fotografische Werk dieser beiden unkonventionellen Reisenden hat sich seither als Referenz in der Schweizer Kunstlandschaft etabliert und erlangte weit über die Landesgrenzen hinaus Kultstatus.
Drei Institutionen bewahren das Erbe dieser aussergewöhnlichen Autorinnen und vermitteln deren einzigartige Sicht auf eine Welt im Wandel. Das Schweizerische Literaturarchiv in Bern betreut den Nachlass von Annemarie Schwarzenbach, der ihr literarisches Werk, ihre Korrespondenz, über 3500 Fotografien und 2000 Negative umfasst. Die Bibliothèque de Genève verwaltet den Nachlass von Ella Maillart, mit all ihren literarischen Werken und Zeitungsartikeln sowie rund 6000 an ihre Eltern und weitere Personen adressierten Briefen, die insgesamt 10 Laufmeter Archivmaterial ausmachen. Das Musée Photo Elysée bewahrt Ella Maillarts Fotobestand, bestehend aus 48 Schachteln, die 10 000 Karten mit Originalabzügen, 1000 Originalabzüge, 23 700 Negative, 35 Alben, 4 Filme, Dias und weiteres Archivmaterial beinhalten.
Annemarie Schwarzenbach, Wegbereiterin der Reisereportage und des Fotojournalismus
Annemarie Schwarzenbach (1908-1942) zählt zu den einflussreichsten Schweizer Autorinnen. Ihre internationale Geltung und die Faszination, die von ihr ausgeht, beruhen auf ihrem vielseitigen Werk und ihrer aussergewöhnlichen Biografie: Sie war Schriftstellerin, Journalistin, Fotografin, Weltenbummlerin, Industriellentochter, Antifaschistin, Kosmopolitin, androgyne Kultfigur und weibliche Rebellin. Indem sie vier Kontinente bereiste, war sie aber vor allem auch eine Wegbereiterin der Reisereportage und des Fotojournalismus des 20. Jahrhunderts.
Ihre grossformatigen Fotoreportagen weisen in sozialer, historischer und politischer Hinsicht kritische Akzente auf und wurden in den bedeutendsten Feuilletons und Illustrierten jener Zeit veröffentlicht. Annemarie Schwarzenbach reiste in die baltischen Staaten, nach Skandinavien, Russland, in den Kongo, nach Marokko und in die Vereinigten Staaten – das künstlerische Herzstück ihres Werks bilden jedoch die vier «Reisen in den Orient», die sie zwischen 1933 und 1939 in die Türkei, in den Libanon, nach Syrien, Palästina, Persien, Afghanistan und Indien führten.
Ihre oft autofiktionalen Prosatexte sowie ihre Fotografien, Briefe und Reportagen, die während dieser Reisen durch mehrere Kontinente entstanden sind, bestechen durch die ausdrucksstarke Verknüpfung von Geschichte und Gegenwart, Selbstreflexion und Fremderfahrung, Bild und Analyse. Insbesondere die illustrierten Erzählungen auf kleinen Karteikarten können als Kompositionen aus Text und Bild gelesen werden, die nicht nur geografische, biografische und kulturelle Brücken schlagen, sondern auch mediale Grenzen überwinden. Getreu ihres poetischen Leitsatzes «Bilder müssen Geschichten erzählen» hat Annemarie Schwarzenbach das Reisen zu einer existenziellen Erfahrung gemacht. Die Originalität ihres Werks beruht auf der geballten und detaillierten Dokumentation ihrer Reisen vor und während des Zweiten Weltkriegs, die sie sowohl aus der Perspektive der Künstlerin als auch aus jener der Journalistin darstellte.
Ella Maillarts humanistische und feministische Betrachtungen der Welt
Ella Maillart (1903–1997) war eine bedeutende Reporterin und Fotografin, eine begabte Rednerin, eine freiheitsliebende und idealistische Leitfigur. Sie wurde in Genf geboren und verbrachte dort auch ihre Kindheit. Die Schule missfiel ihr zwar, sie war jedoch eine begeisterte Sportlerin und praktizierte mehrere Disziplinen auf hohem Niveau. Mit 16 Jahren gründete sie den «Champel Hockey Club», den ersten weiblichen Feldhockeyverein in der Westschweiz. Zusammen mit ihrer Freundin Hermine de Saussure und mit einem ausschliesslich weiblichen Team segelte sie später mehrmals über das Mittelmeer. Bei den Regatten der Olympischen Spiele in Paris 1924 war sie die einzige Frau und jüngste Athletin, die einen Einheitsklassensegler steuerte. Zwischen 1931 und 1934 vertrat sie die Schweiz bei den alpinen Skiweltmeisterschaften.
Im Jahr 1930 unternahm sie ihre erste grosse Reise nach Russland, erkundete Moskau, dokumentierte das Leben junger Menschen in einer kommunistischen Gesellschaft und überquerte den Kaukasus zu Fuss. Später besuchte sie als Korrespondentin des Petit parisien die Mandschurei, die damals unter japanischer Besatzung stand. Es folgten weitere Reisen in oft als gefährlich geltende Gebiete fernab der herkömmlichen Touristenpfade (Russland, Turkestan, Iran, China, Indien, Afghanistan, Türkei usw.). 1939 brach sie mit der Schriftstellerin und Journalistin Annemarie Schwarzenbach in einem Auto nach Afghanistan auf. Während der Wirren des Zweiten Weltkriegs zog sie sich in ein Ashram in Indien zurück, wo sie in die hinduistische Philosophie eintauchte. Zurück in Europa spielte sich ihr Leben hauptsächlich zwischen Chandolin im Wallis und Genf ab. Sie unternahm jedoch bis zu ihrem Lebensende zahlreiche weitere Expeditionen und vermittelte so ihre Lust am Reisen.
Ella Maillart schrieb rund ein Dutzend Bücher über ihre Reiseerfahrungen, in denen die Fotografie eine Rolle einnimmt, die weit über die Illustration hinausgeht. Ihre Werke wurden in mehrere Sprachen übersetzt und immer wieder neu publiziert.
Mit ihren Texten und Bildern lässt uns Ella Maillart die Welt aus einer humanistischen und feministischen Perspektive entdecken. Ihre moderne, eigenwillige Geisteshaltung und ihr unstillbares Interesse für andere Menschen sind auch heute noch eine Quelle der Inspiration. Sie veranschaulichen Mut, Emanzipation und den unerschütterlichen Willen, die Grenzen des Erforschbaren zu erweitern.
Quelle: news.admin.ch

Offizielle Feier am 13. Mai
Am 13. Mai um 18 Uhr findet in der Schweizerischen Nationalbibliothek in Bern eine offizielle Feier zur Aufnahme der Nachlässe von Annemarie Schwarzenbach und Ella Maillart in das UNESCO-Register «Memory of the World» in Anwesenheit von Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider statt.
Das UNESCO-Programm «Memory of the World» (Gedächtnis der Welt) wurde 1992 lanciert.
Es verfolgt das Ziel, das dokumentarische Erbe zu schützen, aufzuwerten und zugänglich zu machen, da dieses eine wesentliche Rolle für das Verständnis der einschneidendsten Ereignisse in der menschlichen Geschichte und Kultur spielt. Das im Rahmen dieses Programms geführte Register des Weltdokumentenerbes (Register «Memory of the World») ist eine der wichtigsten Initiativen des Programms und umfasst Dokumente von universeller Bedeutung (Manuskripte, Archive, Filme oder Tonaufnahmen). Ein Eintrag ins Weltregister würdigt ein dokumentarisches Erbe, schärft das Bewusstsein für dessen Geltung und trägt zur Bewahrung des kollektiven Gedächtnisses bei. Pro Nominierungszyklus kann die Nationalkommission jedes UNESCO-Mitgliedstaats bis zu zwei Kandidaturen für eine Aufnahme ins Weltregister einreichen. Staatenübergreifende Kandidaturen sind nicht limitiert. Der internationale Beirat des Programms bewertet die Kandidaturen nach ihrer historischen, kulturellen, wissenschaftlichen und internationalen Tragweite und legt dem Exekutivrat der UNESCO Empfehlungen vor.

Der Bestand Annemarie Schwarzenbach wurde mit der Unterstützung von Memoriav Erhalten und zugänglich gemacht.
Zum Memoriav-Projekt / Fotografien von Annemarie Schwarzenbach finden Sie online auf der Memobase
Memoriav ruft in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen UNESCO-Kommission alle Schweizer Institutionen, die audiovisuelles Erbe (Fotos, Filme, Videos, Tonaufnahmen) bewahren oder mit diesem arbeiten, zur Teilnahme am Welttag des audiovisuellen Erbes auf, der am 27. Oktober 2025 gefeiert wird.
Dies ist eine einmalige Gelegenheit, um :
– Ihre Institution und Ihre Sammlungen einem breiten Publikum zu präsentieren.
– Ihre Erhaltungs-, Forschungs- und Verwertungsarbeiten bekannt zu machen.
– Das Bewusstsein für die Bedeutung des audiovisuellen Gedächtnisses als kollektives Erbe zu schärfen.
– An einer festlichen und kollaborativen Veranstaltung auf nationaler Ebene teilnehmen.
Memoriav unterstützt Sie dabei, die nationale Sichtbarkeit Ihrer Veranstaltung zu gewährleisten:
– Promotion über unsere Website (Newsletter, soziale Netzwerke).
– Kommunikationskampagne (A2-Plakat, A5-Flyer)
Wie können Sie teilnehmen?
Organisieren Sie zwischen dem 20. Oktober und dem 2. November 2025 eine Aktivität rund um Ihre audiovisuellen Sammlungen: Vorführungen, Ausstellungen, Workshops, Führungen, Online-Veranstaltungen… Lassen Sie Ihre Archive lebendig werden! Lassen Sie sich von vergangenen Initiativen inspirieren oder gehen Sie mit einem originellen Format neue Wege! Senden Sie Ihre Projekte bis zum 25. August 2025 an communication@memoriav.ch :
– Name der Institution
– Datum und Ort der Veranstaltung
– Kurze Beschreibung (+ Weblink, falls vorhanden)
– Lange Beschreibung (optional)
– Illustrationen für das Web (Foto, Poster, Visual)

Eine mysteriöse Chronofotografie, die einen reichen Schweizer Philanthropen zeigt, ist anlässlich des Umzugs der Sammlungen von Photo Élysée nach Plateforme 10 aufgetaucht und liefert eine unerwartete Momentaufnahme der Geschichte, zwei Jahre vor der Erfindung des Kinematographen.
Es ist die Geschichte eines von der Zeit vergrabenen Schatzes inmitten einer Sammlung, die seit ihrer Gründung im Jahr 1985 mittlerweile über eine Million Fotografien umfasst. „Diese Chronofotografie aus dem Jahr 1893 konnten wir beim Umzug der Sammlung von Photo Élysée nach Plateforme 10 wieder schätzen lernen“, verrät Fanny Brülhart. Für die Kuratorin, die seit dreieinhalb Jahren im Amt ist, ist es eine völlig unglaubliche und neue Erfahrung, eine Museumssammlung in ihrer Gesamtheit vorbeiziehen zu sehen. Zwar wurde 2018 mit der umfangreichen Bestandsaufnahme begonnen, um das gesamte Inventar zu überprüfen, doch erst kürzlich tauchte die Chronofotografie Lavanchy-Clarke, die mit einer hübschen Montage aus dem 19. Jahrhundert eingerahmt ist, wieder auf. „Dieses Stück wurde mit dem Phonoskop von Georges Demenÿ (1850-1917) aufgenommen und gehört zu den ungeahnten Schätzen des Museums, die im Verborgenen geblieben sind“, verrät Fanny Brülhart.

Was soll von wem langfristig erhalten, digitalisiert, katalogisiert werden? Wie können kleinere Institutionen eine Auswahl an AV-Dokumenten treffen, die sie bewältigen können? Wie stellen die kulturpolitischen Akteure sicher, dass die gesellschaftliche und kulturelle Vielfalt der Schweiz abgebildet wird? Diese und weitere Fragen zu Sammelstrategien wurden auf der Memoriav Fachtagung 2025 in spannenden Vorträgen und interaktiven Workshops diskutiert.
Die von Memoriav in Zusammenarbeit mit den Kantonen durchgeführte Inventarisierung des audiovisuellen Kulturgutes zeigt eindrücklich, wie viele Sammlungen von Fotos, Filmen, Videos, Tondokumenten und Tonbildschauen in der Schweiz vorhanden sind. Dazu gehören nicht nur kulturelle Institutionen wie Museen, Archive und Bibliotheken, sondern auch unzählige Bild- und Tonbestände in privaten Sammlungen, Vereinen, Kirchgemeinden etc. Damit all diese audiovisuellen Bestände langfristig erhalten und zugänglich gemacht werden können, braucht es realistische Sammlungsstrategien.
Bios & Präsentationen
Bibliographie der Referierenden und Präsentationen (PDF) finden Sie hier.
– – – –
Vom Erben und Entscheiden: Was Sammlungen bieten und fordern | Jacqueline Strauss, Museum für Kommunikation
Zur Präsentation (PDF)
Jacqueline Strauss, Museum für Kommunikation, Bern
ist seit 2010 Direktorin des Museums für Kommunikation in Bern. Unter ihrer Gesamtleitung präsentiert das Museum überraschende Wechselausstellungen wie Sounds of Silence. Strauss ist verantwortlich für die erfolgreiche Gesamterneuerung des Museums; 2019 wird es mit dem Museumspreis des Europarats ausgezeichnet. Seit 2024 ist Strauss Präsidentin von ICOM Schweiz. 2006-2010 leitete sie die Kulturförderung beim Kanton Bern, 1998-2006 war sie Kulturchefin der Stadt Thun. Davor war sie Co-Leiterin eines Kulturzentrums und studierte gleichzeitig Geschichte und Politikwissenschaften. Sie schloss mit einem Lizentiat ab und erwarb den MAS in Kulturmanagement sowie den CAS in Rhetorik und Moderation.
Sammeln in Kleinstmuseen | Franziska Werlen, Walliser Museumsverband
Zur Präsentation (PDF)
Franziska Werlen, Walliser Museumsverband
Während und nach ihrem Phil. I-Studium an der Universität Freiburg i.Ü. arbeitet Franziska Werlen (*1980) in verschiedenen Museen unter anderem im Schloss Spiez und im Museum Murten. Von 2011 bis April 2021 leitet sie das Sensler Museum in Tafers und absolviert von 2016 bis 2018 den MAS Studiengang Kulturmanagement an der Universität Basel. Im April 2021 trat Franziska Werlen die Stelle als Kuratorin Dauerausstellung im Freilichtmuseum Ballenberg an. In dieser Funktion erarbeitet sie im Team Inhalte und Vermittlungsmöglichkeiten für die Bespielung der Museumsgebäude. Seit 2004 inventarisiert sie in einem Minimalpensum die Sammlung des Lötschentaler Museums.
Neben ihrer beruflichen Tätigkeit in einem grossen Museum engagiert sich Franziska Werlen als Co-Präsidentin der Vereinigung Walliser Museen und war gut 10 Jahre lang im Vorstand des Vereins Berner Museen (mmBE). Beiden Vereinen ist die Unterstützung von kleinen Museen in bei der Professionalisierung ihrer Tätigkeiten ein Hauptanliegen.
Bewertung und Übernahme von audiovisuellen Beständen im Staatsarchiv Zürich | Romano Padeste, Staatsarchiv Zürich
Zur Präsentation (PDF)
Romano Padeste, Staatsarchiv Zürich
Ausgebildet zum Wissenschaftlichen Fotografen an der ETH Zürich, sammelte erste berufliche Erfahrungen als Fachfotograf in einem Fotofachgeschäft, wo er erstmals mit historischen fotografischen Sammlungen in Berührung kam. Es folgte ein Masterstudium in Electronic Publishing am Rochester Institute of Technology mit einer Abschlussarbeit zur bildbasierten Suche im Stockfotografie-Markt (1994-1996). Danach war er als Redaktor und Desktop Publisher für fotografische Fachzeitschriften tätig. Anschließend arbeitete er über ein Jahrzehnt in verschiedenen technischen Rollen – vom Support über Training bis hin zur Produktentwicklung – bei einem Hersteller professioneller Kamerasysteme. Seit 2010 ist er im Staatsarchiv Zürich in der Beständeerhaltung tätig, wo er das Kompetenzzentrum für audiovisuelle Medien aufbaute. Heute leitet er das Team Medien und Daten und ist stellvertretender Abteilungsleiter. Zudem engagiert er sich in der Preservation Planning Expert Group (PPEG) der KOST.
Penser et porter l’archivage audiovisuel à Genève : la démarche de la Bibliothèque de Genève | Frédéric Sardet, Bibliothèque de Genève
Präsentation steht nicht zur Verfügung.
Frédéric Sardet, Bibliothèque de Genève
Historien et économiste. Depuis février 2019 directeur de la Bibliothèque de Genève. 2009 – janvier 2019, chef de service, en charge des Bibliothèques & Archives de la Ville de Lausanne. Depuis 1997, les Archives sont engagées dans une politique active de préservation du patrimoine audiovisuel (film, vidéo, sons) et restent également actives dans la production (sons, vidéo). A titre personnel, auteur d’une cinquantaine de contributions scientifiques ou archivistiques.
Mit Marie Kondo im Depot: Lehren aus Inventarisierungsprojekten | Severin Rüegg, SKKG und Mirco Melone, Historisches Museum Basel
Zur Präsentation (PDF)
Severin Rüegg, Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte
Severin Rüegg leitet seit 2020 die Aufarbeitung der Sammlung der SKKG (Stiftung für Kunst Kultur und Geschichte), die sehr umfangreich, heterogen und über Jahrzehnte vernachlässigt war. Zuvor arbeitete er mehr als 10 Jahre als freischaffender Historiker und Kurator. Er ist Vater von zwei Kindern und lebt mit der Familie in Zürich.
Mirco Melone, Historisches Museum Basel
ist Historiker mit Schwerpunkt Fotografie-, Medien- und Digitalgeschichte. Seit 2009 arbeitet er im Sammlungs- und Projektmanagement für verschiedene Schweizer Museen und Archive, aktuell für das Historische Museum Basel.
Réseau photo romand : l’informel au service de la pratique| Diana Le Dinh, Musée Historique Lausanne
Vers la présentation (PDF)
Diana Le Dinh, Musée Historique Lausanne
Diana Le Dinh a fait des études de lettres à l’Université de Lausanne, où elle a obtenu un master en histoire contemporaine. Depuis plus de vingt ans elle travaille comme conservatrice du Département des Collections de photographies du Musée Historique Lausanne. Parallèlement à la gestion de son département, elle réalise régulièrement des expositions portant soit sur les collections soit sur des thématiques sociétales et/ou historiques. La dernière en date, Frontières (2024), était consacrée au Traité de Lausanne et à ses répercussions de 1924 à nos jours.
Praktische Informationen – Memoriav Fachtagung 2025
Infos zur Weiterbildungsveranstaltung werden hier laufende aufgeschaltet.
- Titel:
Zwischen Sammelwut und Sammlungsstopp - Datum:
25.06.2025 - Ort:
Uni vonRoll, Fabrikstrasse 6, Bern – mit Buslinie 20 bis Endstation «Länggasse».
Zum Lageplan - Online: Der Vormittag der Fachtagung wird auch online übertragen, allerdings ohne Übersetzung
- Programm:
Programm Memoriav Fachtagung 2025 (PDF)
- Preise:
– Mitglieder von Memoriav oder der Parnterinstitutionen: CHF 230
– Nicht-Mitglieder: CHF 350
– Studierende: CHF 50
– Online-Teilnahme (nur am Morgen ohne Übersetzung): CHF 120.-
Der Link zur Onlineteilnahme wird Ihnen kurz vor der Veranstaltung per Mail zugeschickt. - Übersetzung
Für die Teilnehmenden vor Ort steht eine Simultanübersetzung (Deutsch-Französisch / Französisch – Deutsch) zur Verfügung. - Partner:
Die Fachtagung wird in Zusammenarbeit mit dem Weiterbildungsprogramm in Archiv-, Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Universitäten Bern und Lausanne (CAS/MAS ALIS) organsiert. - Weitere Partner der Veranstaltung sind die folgenden Partner/-Fachverbände, die vom reduzierten Mitgliederpreis profitieren:
– KOST
– Bibliosuisse
– Verein Schweizerischer Archivarinnen und Archivare (VSA)
– Verband der Museen der Schweiz (VMS – ICOM Schweiz).

In Zusammenarbeit mit Memoriav bieten Ødegård & Bernard Restaurierung und AV Preservation by reto.ch einen weiteren Workshop an, der aktuelle Kenntnisse der sich rasch ändernden digitalen Landschaft vermittelt oder aktualisiert.
Wie kann mit Videodateien fachgerecht umgegangen werden? Die Teilnehmer:innen lernen, wie sie ihre Arbeit mittels der Open-Source-Software FFmpeg auf ihrem Computer ausführen, vereinfachen oder verbessern können. In Gruppen werden Lösungen für mitgebrachten Fragestellungen und Aufgaben erarbeitet. Gemeinsam wird so eine Sammlung an hilfreichen FFmpeg-Commands für den Umgang mit audiovisuellen Dateien im Erhaltungskontext zusammengetragen. Dies ist ein praktischer Workshop mit einem kleinen theoretischen Teil. Jede:r Teilnehmende soll ein Fallbeispiel oder ein Problem mitnehmen, dass sie/er während des Kurses lösen will (zum Beispiel Deinterlacing, CD oder DVD «rippen», SD-Dateien auf einem HD-Monitor darstellen).
Zielpublikum:
Der Workshop richtet sich an Fachpersonen, die bei ihrer täglichen Arbeit in Archiven, Bibliotheken und Museen mit audiovisuellen Dateien umgehen müssen. Dieser weiterführende Kurs ist für Fortgeschrittene gedacht: Es wird vorausgesetzt, dass die Teilnehmende das Terminal beziehungsweise die Kommandozeile benützen und damit einfache FFmpeg-Befehle selbständig ausführen können, wie im Einführungskurs vermittelt. Die Teilnehmer:innen sollten einen Computer mit einem nicht allzu alten Linux-, macOS oder Windows-Betriebsystem benützen und die Version 7.1 («Péter») von FFmpeg ist empfohlen.
Inhalt:
– einfache und komplexe Ton- und Bildumwandlungen
– Metadaten aus audiovisuellen Dateien extrahieren und interpretieren
– Möglichkeiten des Qualitätskontrolle
– Vor- und Nachteile von unterschiedliche Szenarien (und Standards)
– FFmpeg als Teil eines Ökosystems von Open-Source-Softwarepaketen
Praktische Details zum Weiterbildungsangebot:
Ort:
In den Räumlichkeiten der Memoriav-Geschäftsstelle:
Sulgenrain 20, 3007 Bern
Termin:
Donnerstag, den 13. März 2025
am Morgen von 9 Uhr 30 bis 12 Uhr 30 mit einer Kaffeepause
am Nachmittag von 13 Uhr 30 bis 16 Uhr 30 mit einer Teepause
Anzahl Teilnehmende:
5 bis 15
Preis:
inklusive Kursunterlagen und Mittagessen:
– CHF 300
– CHF 200 für Memoriav-Mitglieder
– CHF 50 für Studierende
– Besuch beider Workshop Einführung und Aufbaukurs: CHF 350 (für Mitglieder), CHF 550 (für Nicht-Mitglieder)
Anmeldung;
bis zum 5. März 2025 via Online-Formular.
Workshopleitende:
Reto Kromer und Kamilla Ødegård
Bemerkungen:
Dieser Kurs wird auch in französischer Sprache angeboten.
Zusammenarbeit:
AV Preservation by reto.ch
Ødegård & Bernard Restaurierung
Memoriav
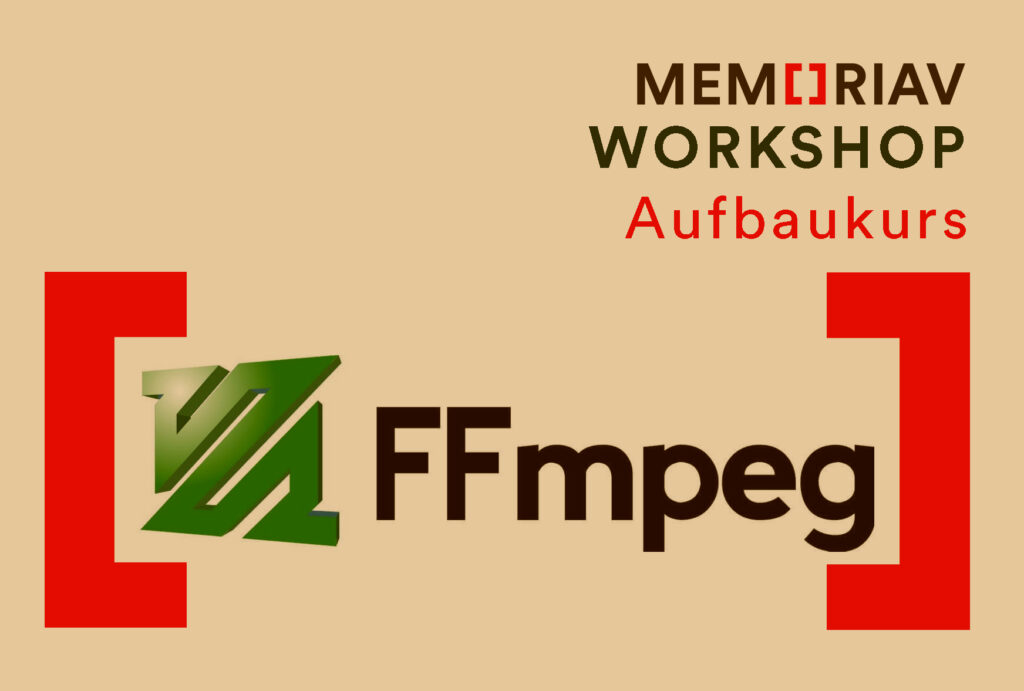
Online-Anmeldeformular
Memoriav-Workshop: Einführung in FFmpeg vom 13.3.2025
Am 26. November 2024 organisiert Memoriav, die Kompetenzstelle für das audiovisuelle Erbe der Schweiz, im Landhaus Solothurn den ersten nationalen Kongress zum audiovisuellen Kulturgut in den Kantonen. Für diesen Grossanlass werden rund 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. In Anwesenheit der Vorsteherin des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI), Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider, sowie Vertreter*innen der Kantone werden die ersten Ergebnisse des nationalen Memoriav-Projekts «Kantonale audiovisuelle Übersichtsinventare der Schweiz» öffentlich vorgestellt und diskutiert.
Ein nationales Rendez-vous mit attraktivem «Marché»
Memoriav nimmt die ersten Ergebnisse seines noch laufenden Inventarprojekts zum Anlass, um zusammen mit Vertreter*innen der Kantone am 26. November 2024 im Landhaus Solothurn einen nationalen Kongress zu organisieren. Dieser soll ein offenes Diskussionsforum für Fachleute, Kantonsvertreter*innen und alle, die sich für die Erhaltung des audiovisuellen Erbes interessieren, bieten. Mit Inputreferaten des Bundesamtes für Kultur, Kurzreferaten zur Situation audiovisueller Kulturgüter in den Kantonen Tessin, Freiburg, Jura und Schwyz sowie einer Podiumsdiskussion zu den Strategien für das audiovisuelle Kulturerbe, an der die frühere Genfer Nationalrätin Martine Brunschwig-Graf, die jurassische Ständerätin Mathilde Crevoisier Crelier, der Vorsteher des Amtes für Kultur Nidwalden, Stefan Zollinger, und der Leiter des Amtes für Kultur des Kantons Aargau, Georg Matter, teilnehmen, werden aktuelle Herausforderungen und Lösungsansätze für eine nachhaltige Erhaltung des audiovisuellen Erbes der Schweiz in Zusammenarbeit mit den Regionen diskutiert.
Parallel zu den Vorträgen findet ein «Marché» statt, an dem 23 Kantone, neun nationale Institutionen und sieben innovative Projekte mit audiovisuellen Dokumenten teilnehmen. Diese Plattform ermöglicht den Austausch lokaler und nationaler Initiativen und bietet den Kantonen die Gelegenheit, ihre Erfahrungen, Herausforderungen und Erfolge bei der Verwaltung audiovisueller Archive – von Fotografien bis hin zu Ton- und Videoaufnahmen – zu teilen. Zum Programm des Memoriav Kongresses
Ein wichtiges Projekt für die Schweizer Kulturpolitik
Im Auftrag des Bundesamtes für Kultur (BAK) arbeitet Memoriav seit 2022 zusammen mit den Kantonen an der Erstellung eines präzisen Verzeichnisses des audiovisuellen Erbes der Schweiz in analoger und digitaler Form. Die Kantone spielen in diesem Projekt eine zentrale Rolle, indem sie die Erfassung der lokalen audiovisuellen Archive übernehmen. In Zusammenarbeit mit Memoriav tragen sie zu einer nationalen Kartografie bei, welche die kulturelle und historische Vielfalt jeder Region widerspiegelt. Diese Kartografie des audiovisuellen Erbes ist ein wichtiges Instrument für die Anpassung der Kulturpolitik des Bundes und der Kantone. Sie wird es ermöglichen, die Strategien zur Sammlung, Erhaltung und Vermittlung der audiovisuellen Archive gezielter auszurichten. Schliesslich wird diese umfassende Karte die Herausforderungen bei der Erhaltung dieses einzigartigen Erbes aufzeigen und strategische Unterstützung für dessen langfristigen Schutz bieten. Um die Kantone bei ihrem Vorgehen zu unterstützen, hat Memoriav einen praktischen Leitfaden entwickelt, der auf den Erkenntnissen aus den Pilotprojekten basiert. Dieser Leitfaden mit dem Titel «Erfassung des audiovisuellen Erbes in den Kantonen» enthält Empfehlungen für die Durchführung präziser Inventare und die Auswertung der gesammelten Daten. Informationen zum Memoriav-Inventarprojekt
Filmperle, die im Rahmen des kantonalen Inventarprojekts im Wallis entdeckt wurde: Die Furkatalbahn in den 1910er-Jahren. Filmstill: Privatarchiv Willy Lohr
Klick auf das Bild, um das Bild in guter Auflösung.
Kontakt für die Medien:
Cécile Vilas, Direktorin Memoriav: cecile.vilas@memoriav.ch oder 031 380 10 82
Medienschaffende, die am Kongress dabei sein möchten, schicken ein Mail an: communication@memoriav.ch
Für bestehende und zukünftige Mitarbeitende von Gedächtnisinstitutionen bietet Memoriav ab 2025 neu einen dreitägigen Basiskurs an, der die Grundlagen im Umgang mit Fotos, Filmen, Videos und Tondokumenten vermittelt.
Immer mehr Gedächtnisinstitutionen stehen vor der dringenden Aufgabe, die fragilen audiovisuellen Medien in ihren Sammlungen langfristig zu erhalten. Der neue Basiskurs von Memoriav bietet Mitarbeitenden von Institutionen mit audiovisuellen Dokumenten die Gelegenheit, die nötigen Kenntnisse für den Umgang mit Fotos, Filme, Videos und Tondokumenten zu erwerben. Memoriav ist die Kompetenzstelle für das audiovisuelle Kulturerbe der Schweiz.
Im Zentrum der dreitägigen Ausbildung stehen die materiellen Besonderheiten von analogen Fotos, Filmen, Videos und Tondokumenten. Die Kursteilnehmenden lernen anhand von theoretischen Überblicken und praktischen Übungen die wichtigsten Verfahren, Formate und Materialien kennen, wie sie zu behandeln sind und welche Bedingungen die langfristige Erhaltung verbessern. Dazu kommt am letzten Tag eine Einführung in den Umgang mit digitalen Trägern wie Disketten, Memorysticks etc., auf denen häufig audiovisuelle Dokumente zu finden sind.
Für die Durchführung des Basiskurses kann Memoriav auf ausgewiesene Expertinnen und Experten im Feld der audiovisuellen Erhaltung mit Erfahrung in der Aus- und Weiterbildung zählen. Teilnehmende, die alle Kursteile besuchen, wird eine offizielle Kursbestätigung in Form eines Memoriav-Zertifikats ausgestellt.
Zielpublikum
Der Kurs ist speziell für aktuelle und zukünftige Mitarbeitende von Gedächtnisinstitutionen gedacht, die mit der Erhaltung von audiovisuellen Medien zu tun haben. Gerade Digital Natives, die ohne analoge Fotos, Filme, Videos und Tondokumente aufgewachsen sind, kommen dank des Kurses mit diesen audiovisuellen Materialien in Berührung.
Details zur Ausbildung
Memoriav Basiskurs: Grundlagen zur Identifikation und Erhaltung von audiovisuellen Medien
- Dauer, Daten, Kursorte
Der Kurs dauert drei Tage und findet jeweils an einem Freitag statt. Daten 2025 sind 9.5., 23.5., 6.6. Der erste Kursteil findet immer an der Geschäftsstelle von Memoriav in Bern statt und wird je nach Thema im Atelier Reding (Liebefeld), der Lichtspiel Kinemathek (Bern) und im Atelier für Medienkonservierung (Bern) fortgesetzt.Kursplan
9.5.2025 – 1. Kurstag
9.15-16.45 Uhr, Geschäftsstelle Memoriav (Bern) und Atelier Reding (Liebefeld)
– Einführung (Felix Rauh, Memoriav)
– Fotografie: Verfahren, Materialien, Erhaltungsbedingungen (Nadine Reding, Atelier Reding)23.5.2025 – 2. Kurstag
9.15-16.45 Uhr, Geschäftsstelle Memoriav (Bern) und Kinemathek Lichtspiel (Bern)
– Film und Video: Unterschiede, Erscheinungsformen und Materialien, Erhaltungsbedingungen (Brigitte Paulowitz, David Landolf, David Pfluger, Lichtspiel)6.6.2025 – 3. Kurstag
9.15-16.45, Geschäftsstelle Memoriav (Bern) und Atelier für Medienkonservierung (Bern)
– Ton: Formate, Materialien, Erhaltungsbedingungen (Rudolf Müller, Memoriav, Ralph Michel, Atelier für Medienkonservierung)
– Digitale Träger: Erscheinungsformen, Handling (Ralph Michel, Atelier für Medienkonservierung)Adressen der Kursorte:
– Memoriav Geschäftsstelle, Bern
– Atelier Reding, Liebefeld
– Lichtspiel Kinemathek, Bern
– Atelier für Medienkonservierung, BernKosten, Anmeldung + Termine
Für Mitglieder CHF 840, für Nichtmitglieder CHF 1’040
Die Anmeldung erfolgt über die E-Mail-Adresse basiskurs@memoriav.ch. Anmeldeschluss ist 31. Januar 2025. Der Kurs ist ausgebucht, wir führen aber eine Warteliste. Melden Sie sich, wenn Sie interesse an diesem Kurs haben.
Die Bezahlung der Kursgebühren erfolgt auf Rechnung, die nach der Anmeldung verschickt wird. Die Abmeldung vor Anmeldeschluss hat keine Kostenfolge. Bei Abmeldungen nach Anmeldeschluss wird das volle Kursgeld fällig, ausser es kann ein Ersatz gefunden werden.
Kaffee, Tee, Wasser und Mittagessen sind in den Kurskosten inbegriffen.Unterrichtsform, Sprache + Unterlagen
Während der drei Tage wechseln sich Präsentationen in der Klasse mit praktischen Übungen mit den audiovisuellen Materialien ab. Die Unterrichtssprache ist vorerst Deutsch. Der Kurs steht selbstverständlich auch für französischsprachige Teilnehmende mit Deutschkenntnissen offen. Die wichtigsten Begriffe werden übersetzt, Fragen können in Französisch gestellt werden, bei Verständnisproblemen kann die Kursmoderation punktuelle Übersetzungshilfe leisten. Die in den Kursen verwendeten Präsentationen sowie ausführliche Link- und Literaturlisten werden zur Verfügung gestellt.Anzahl Teilnehmende
Der Kurs findet statt, wenn sich mindestens 7 Personen angemeldet haben. Maximal können 12 Personen teilnehmen.
Der Kurs ist ausgebucht, wir führen aber eine Warteliste. Melden Sie sich, wenn Sie interesse an diesem Kurs haben.
Dozierende
– Nadine Reding (Fotorestauratorin, Inhaberin Atelier Reding)
– David Pfluger (Chemiker, Filmerhaltungsspezialist, Leiter Archiv Lichtspiel / Kinemathek)
– David Landolf (Direktor Lichtspiel / Kinemathek)
– Brigitte Paulowitz (Filmrestauratorin, Verantwortlich für Erhaltungsprojekte, Lichtspiel / Kinemathek)
– Ralph Michel (Konservator, Restaurator für neue Medien, Atelier für Medienkonservierung)
– Rudolf Müller (Verantwortlicher Bereich Ton, Memoriav)
– Felix Rauh, Kursleiter (Verantwortlicher Aus- und Weiterbildung, Memoriav)
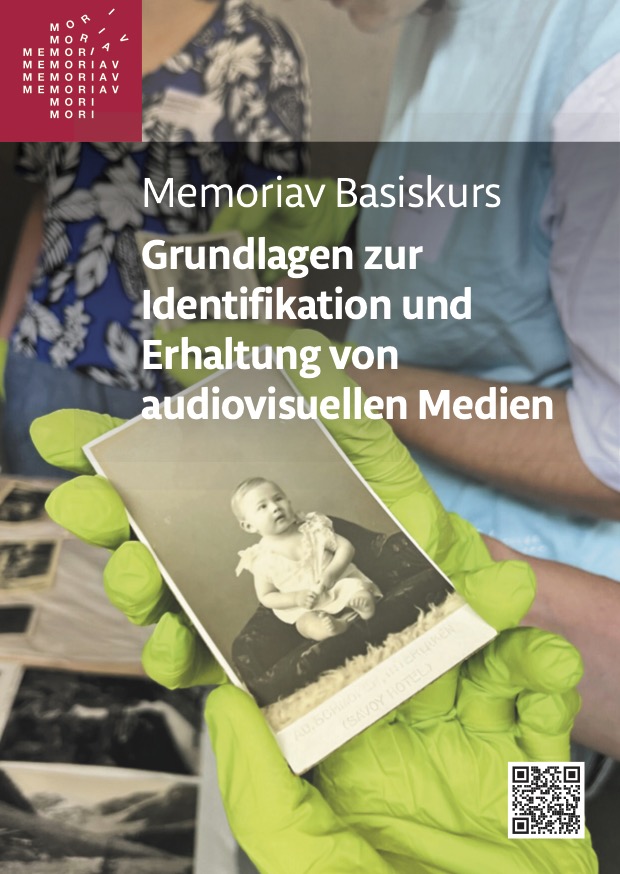
Das Lichtspiel zeigt im Rahmen von Archivschätze die filmische Dokumentation von Jacqueline Veuve über die Tagebuchaufzeichnungen (1941 und 1942) der Basler Rotkreuz-Mitarbeiterin Friedel Bohny.
Als Betreuerin beim Roten Kreuz engagierte sich die Baslerin Friedel Bohny (1912-2001) während des Zweiten Weltkriegs in südfranzösischen Lagern für die dort angekommenen Kinder aus jüdischen und Familien der Sinti und Roma. In ihrer Funktion sowie durch List und Mut gelang es ihr, zahlreiche der Kinder vor der weiteren Deportation zu retten. In ihrer aufmerksamen und sorgfältigen Dokumentation macht sich die 2013 verstorbene Filmemacherin Jacqueline Veuve auf der Grundlage von Friedel Bohnys Tagebuchaufzeichnungen aus den Jahren 1941 und 1942 auf eine Spurensuche nach den unteilbaren Erfahrungen des Schmerzes, aber auch den Momenten der Hoffnung, welche die damals junge Rotkreuz-Mitarbeiterin begleitet haben. Und Jaqueline Veuve reist noch einmal zum damaligen Wirkungsort von Friedel Bohny und besucht mit ihr das verwaiste Auffanglager.
Film: Jacqueline Veuve CH 1997, F/d, 75′
Wann: Montag, 21. Oktober 2024, Film ab 20 Uhr, Bar ab 19 Uhr
Wo: Lichtspiel / Kinemathek Bern

Restaurierte Filme (wieder)entdecken
Mit dem Programmfenster Archivschätze bietet das Lichtspiel in Zusammenarbeit mit der Cinémathèque suisse und Memoriav die Gelegenheit, restaurierte Filme aus der Schatztruhe der Cinémathèque suisse (wieder) zu entdecken. Weitere Informationen und nächste Vorführungen
Der Filmbestand der «Schweizer Filmwochenschau» ist ab sofort auch auf nanoo.tv verfügbar, der kollaborativen Online-Mediathek und Filmplattform für Bildungsinstitutionen von der Primar- bis zur Tertiärstufe und Bibliotheken.
Die fünf- bis achtminütigen Beiträge eignen sich hervorragend für den Unterricht in Geschichte, Politik, Allgemeinbildung und NMG. Die Sammlung enthält auch zahlreiche Beiträge in französischer und italienischer Sprache für den Einsatz im Sprachunterricht sowie im immersiven oder bilingualen Unterricht. Die Filmwochenschau war sozusagen die staatliche Wochenschau, die während des Zweiten Weltkriegs und des Kalten Krieges im Auftrag des Bundesrats als Vorprogramm in den Schweizer Kinos gezeigt wurde. Sie stand im Dienst der “geistigen Landesverteidigung” und prägte das kollektive audiovisuelle Gedächtnis der Schweiz. Die wertvollen Bestände geben einen lebendigen Einblick in das politische, gesellschaftliche und kulturelle Geschehen der Schweiz in dieser Zeit.
Um den Bestand zu nutzen, muss im Profil bei «zusätzliche Videosammlungen“ das Häkchen «Filmwochenschau», bzw. «ciné-journal suisse» oder «cinegiornale svizzero» gesetzt werden.
Dieses Angebot entstand dank der Zusammenarbeit mit Memoriav, dem Verein zur Erhaltung des audiovisuellen Kulturerbes der Schweiz, mit dem Schweizerischen Bundesarchiv und mit der Cinémathèque suisse.
nanoo.tv
Mit nanoo.tv auf die schweizweit von Lehrpersonen kuratierte Video- und Filmsammlung zugreifen oder Videos aus Internet und Fernsehen selbst einfach sammeln, organisieren, bearbeiten, in Fachgruppen und schulübergreifend teilen, unlimitiert speichern und für den selbstorganisierten Unterricht nutzen. Mehr zum Einsatz von nanoo.tv im Unterricht





























